Ich bin stets von Autoren eingenommen, die sich ernsthaft mit einem Thema auseinandersetzen und mir das Gefühl geben, etwas erzählen zu wollen. Aus diesem Grund bin ich auch eingenommen von Andrei Mihailescu und würde gerne nur Gutes über seinen Debütroman „Guter Mann im Mittelfeld“ schreiben, aber leider, leider hat er sich entschieden, eine Liebesgeschichte in den Mittelpunkt der Handlung zu stellen. Und manchmal ist Liebe nicht die Antwort, sondern das Problem.
Die Handlung in wenigen Sätzen: Rumänien in den Achtzigerjahren. Stefan ist  systemkritisch, schreibt jedoch als angestellter Journalist tagaus tagein systemkonforme Artikel. Er unterschlägt Leserbriefe mit kritischem Inhalt, um die Absender vor dem Geheimdienst zu schützen. So gerät er selbst ins Visier. Als er dem Securitate-Beamten der Zeitungsredaktion die Nase bricht, wird er verhaftet, mehrere Tage festgehalten, immer wieder verprügelt. Nach seiner Freilassung lernt er Raluca, die Ehefrau eines Parteifunktionärs kennen. Sie verlieben sich ineinander und beginnen eine Affäre. Ilie, der Ehemann, erfährt von der heimlichen Beziehung seiner Frau. Sie lassen sich scheiden. Mit Hilfe eines Freundes beim Geheimdienst rächt sich Ilie an Stefan. Dieser kommt für mehrere Jahre ins Gefängnis.
systemkritisch, schreibt jedoch als angestellter Journalist tagaus tagein systemkonforme Artikel. Er unterschlägt Leserbriefe mit kritischem Inhalt, um die Absender vor dem Geheimdienst zu schützen. So gerät er selbst ins Visier. Als er dem Securitate-Beamten der Zeitungsredaktion die Nase bricht, wird er verhaftet, mehrere Tage festgehalten, immer wieder verprügelt. Nach seiner Freilassung lernt er Raluca, die Ehefrau eines Parteifunktionärs kennen. Sie verlieben sich ineinander und beginnen eine Affäre. Ilie, der Ehemann, erfährt von der heimlichen Beziehung seiner Frau. Sie lassen sich scheiden. Mit Hilfe eines Freundes beim Geheimdienst rächt sich Ilie an Stefan. Dieser kommt für mehrere Jahre ins Gefängnis.
Eindringlich schildert Mihailescu in seinem Roman die dystopisch anmutenden Zustände im Rumänien der Achtziger. Jede Buchseite ist geprägt von einer Atmosphäre, die durch Armut, Lebensmittelknappheit, Überwachung und Paranoia entsteht.
„Die Güte hatte man ihnen ausgetrieben: Zeige deinen Nachbarn an, und du bekommst eine Wohnung in der Hauptstadt, eine Stelle, einen Dacia, einen Kühlschrank, du treuer Sohn des Vaterlandes. Hier, solange du so handelst, hast du deinen Krümel Wohlstand und ein wenig Schutz. Auf Kosten derer, die du ausgeliefert hast oder die einfach schwächer, unwichtiger sind. Etwa ein Streuner, den kann man sogar selbst prügeln, geht in Ordnung, den vermisst niemand.“
Deutlich wird dem Leser vor Augen geführt, wie sich innerhalb der Diktatur Ceausescus die gesamten gesellschaftlichen Strukturen verändert haben. Besonders plastisch wird dies erzählt, als Stefan im Rahmen einer Recherche den früheren Dorfpfarrer Salajan trifft. Dieser berichtet ihm davon, wie damals die Menschen mit großen Versprechungen vom Dorf in die Stadt gelockt wurden. Sie träumten vom Dacia, Radio, Fernseher und Telefon und leben nun in Elendsquartieren am Rande der Stadt.
„Die Heimatlosigkeit nistet sich ein, wird zu einer Lebensart. Eine Schicht entsteht, die keine ländliche und keine städtische Identität hat.“
Dem Autor gelingt es in seinem Roman, den gesellschaftspolitischen Hintergrund und die Atmosphäre der damaligen Zeit zu rekonstruieren. Doch nun beginnt das große Aber: er findet nicht die richtigen Mittel, um das eindringliche Moment des Hintergrundes auch in Handlung, Figuren und Sprache einfließen zu lassen. Die Kraft und das Gewicht des Hintergrundes übertragen sich nicht auf die eigentliche Erzählung.
Da ist zum einen die Handlungsebene: Während der Lebensraum Redaktion, in dem sich Stefan bewegt, sowie die Geschichte rund um die abgefangenen Leserbriefe vielversprechende Erzählanlässe geboten hätten, hat sich Mihailescu für die Liebe entschieden. Der Autor stellt die altbekannte Dreiecksbeziehung in den Fokus und sich selbst damit ein Bein. Die Verbindung „Liebesgeschichte“ und „historischer Hintergrund“ ist nun mal sehr beliebt und jenseits des Klischees schwer zu bewältigen. Natürlich kann das gute alte Beziehungsdreieck auch heute noch in der Literatur funktionieren, ohne dass es gleich der neue Tolstoi sein muss, aber leider erinnert die Verbindung von gesellschaftshistorischem Hintergrund und Liebesgeschichte immer schnell an die konventionelle Machart eines ZDF-Zweiteilers. Und Mihailescu schafft es nicht, dieses konventionelle Gerüst durch unkonventionelles Erzählen oder unkonventionelle Figuren zu brechen.
Die Figuren besitzen nicht genug Kraft und Brüchigkeit, ich will gar nicht von Originalität sprechen, um sich weit vom Klischee oder einer Typenhaftigkeit zu entfernen. Die Figuren in dem Roman sind wenig überraschend, sie tun genau das, was man von ihnen erwartet. Da ist die hübsche Ehefrau des Parteifunktionärs, die sich aber nicht alles sagen lässt. Sie trifft auf den einsamen Wolf (das Überraschendste ist vielleicht, dass der noch bei seiner Mutter wohnt). Und da ist der grobschlächtige Ehemann, der nur an seine Karriere denkt und früher doch mal anders war, mit Idealen und so.
„Sie war eine starke Frau. Ihr Leben war nicht immer einfach gewesen, sie hatte früh ihre Eltern verloren, sie hatte hart arbeiten müssen. Sie hatte etwas erreicht. Raluca stand auf und ging wortlos zur Treppe. Sie drehte den Kopf. Sie sah Ilie: Er hielt den Löffel immer noch in der Faust wie ein Mauerer die Kelle und schaufelte Fleisch- und Kartoffelstücke in sich hinein.“
Diese wenig überraschende Ausgangslage mündet dann in einer erwartbaren Handlung. Das Problem dieser erwartbaren Handlung wird noch dadurch verstärkt, dass aus mehreren Perspektiven erzählt wird. Zu allem Überfluss wissen wir somit immer ganz genau, was Raluca, Stefan oder Ilie denken. Es wird alles auserzählt, es gibt keine Freiräume für den Leser, keinen Leerstellen, die er selbst füllen kann.
Auch die nüchterne Sprache schafft es nicht, den Roman aus dem Mittelfeld zu heben. Mihailescu findet kaum überraschende Bilder. Wenn er sich an Bilder wagt, wirken sie noch ein wenig ungelenk, wie: „die Bushaltestelle war eingeschweißt in der dickflüssigen Mittagshitze“ oder „und ließ ihren Überdruss hart auf sein Haupt fallen“.
Es gibt immer wieder einzelne Szenen, die mich mitgenommen und auch bewegt haben, wie die Begegnung zwischen Raluca und dem Neffen von Ceausescu auf einer Party. Der Neffe wird Raluca gegenüber übergriffig, während ihr Ehemann nur zusieht und nicht eingreift. Doch am Ende bleibt, dass die vorhersehbare Handlung mit typisierten Figuren vor diesem ernsthaften Hintergrund einfach nicht so richtig funktioniert will, und ich hoffe sehr, dass Andrei Mihailescu den Mut hat, mit seinem zweiten Roman die Sicherheit des Mittelfeldes zu verlassen.
[Andrei Mihailescu – Guter Mann im Mittelfeld
352 Seiten, 2015, gebunden, 22,90 €]
Auftakt:
„Die Bushaltestelle war eingeschweißt in der dickflüssigen Mittagshitze.“
 Andrei Mihailescu wurde 1965 in Bukarest geboren. 1981 floh er mit seiner Familie aus Rumänien in die Schweiz, dort studierte er Informatik an der ETH, später Politikwissenschaften und Ethnologie an der Universität Zürich. Mihailescu lebt heute in der Nähe von Zürich und arbeitet als Informatiker. Er engagierte sich in zahlreichen kulturellen und Menschenrechtsprojekten mit dem Fokus Osteuropa. Sein Debütroman „Guter Mann im Mittelfeld“ wurde 2014 mit einem Werkpreis des Kantons Zürich ausgezeichnet.
Andrei Mihailescu wurde 1965 in Bukarest geboren. 1981 floh er mit seiner Familie aus Rumänien in die Schweiz, dort studierte er Informatik an der ETH, später Politikwissenschaften und Ethnologie an der Universität Zürich. Mihailescu lebt heute in der Nähe von Zürich und arbeitet als Informatiker. Er engagierte sich in zahlreichen kulturellen und Menschenrechtsprojekten mit dem Fokus Osteuropa. Sein Debütroman „Guter Mann im Mittelfeld“ wurde 2014 mit einem Werkpreis des Kantons Zürich ausgezeichnet.
![[Das Debüt 2023] Der Preis geht an…](https://dasdebuet.files.wordpress.com/2024/01/birobidschan-cover_dbp-longlist-500x715-1.jpg?w=500)
![[Das Debüt 2023] Die Shortlist](https://dasdebuet.files.wordpress.com/2024/01/shortlist-2023.png?w=720)

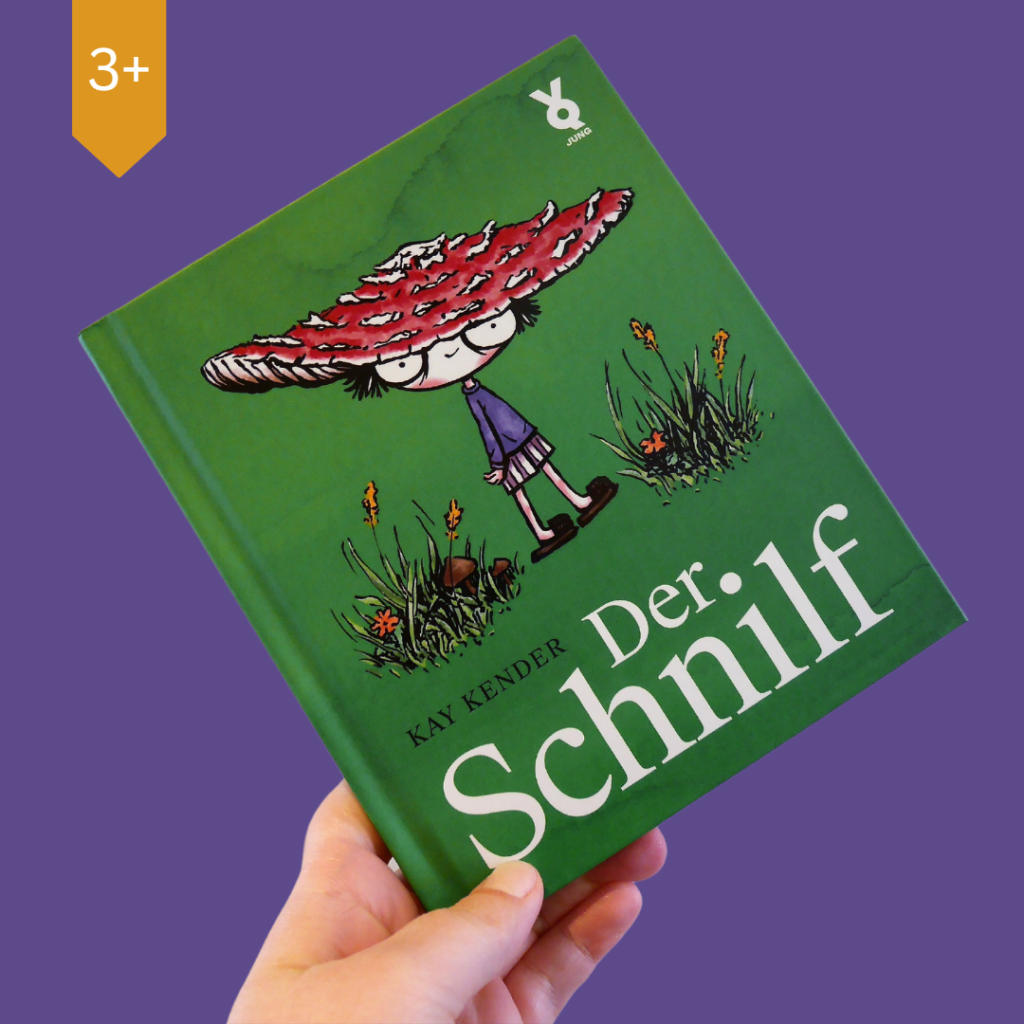
Hinterlasse einen Kommentar